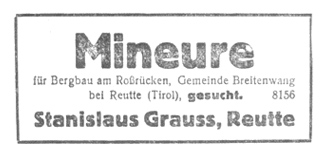Geschichte
Noch heute finden sich in Karten der Umgebung Hinweise auf teils mittelalterliche Erzabbaustätten in den umliegenden Bergen. Etwa der
Erzberg (nahe dem Frauensee bei Lechaschau) oder der
Galmeikopf am Pinswanger Schwarzenberg und viele andere Flurbezeichnungen lassen auf einen historischen Bergbau, mindestens schon seit dem frühen Mittelalter, schließen.
Ob es bereits zur Zeit der Kelten einen Erzabbau und eine Verhüttung von Metallen in unserem Bereich gegeben hat wird zwar immer wieder einmal vermutet, eindeutige Belege dafür gibt es jedoch nicht.
Anhand konkreter Spuren und einer bereits laufenden wissenschaftlichen Erforschung der Abbaustätten aber auch Schlackenhalden im Bereich des Allgäus und des Außerferns, kann inzwischen schon auf eine beachtliche Fülle an Erkenntnissen zurückgegriffen werden. So wurden bisher rund 50 verschiedene Fundstellen von Schlacken aufgezeigt.
Die Schlacken bzw. die der Schlacke anhaftenden Holzkohlestücke dienten der Wissenschaft zur Bestimmung der unterschiedlichen Zeitspannen in welchen das Erz in einfachen Rennöfen verhüttet wurde. Dieser Zeitraum der regional verhütteten heimischen Erze reicht vom 7. bis in das 14. Jahrhundert.
Vor allem die Schichten des Wettersteinkalkes beinhalten erzhaltiges Gestein und waren für die ersten Bergbautreibenden von Interesse. Wurden zu Beginn noch oberflächennahe Erzadern abgebaut (Eisenerz), trieb man bald auch kleinräumige Stollen in die Felsen um an die Erzlager entlang der Schichtungen im Inneren des Berges zu gelangen (Silber, Blei und Galmei -> Zink).


Bergbau im 16. Jahrhundert

schematische Darstellung eines Rennofens -
auf einer Infotafel bei den Pinswanger Erzgruben

Transport des Erzes mittels eines Sackzuges
Eine der ältesten Erwähnungen steht in Verbindung mit dem Heiligen Magnus von Füssen, welcher seit etwa Mitte des 8. Jahrhunderts im Gebiet um Füssen als Missionar wirkte und somit in die merowingische Zeit fällt.
Im Jahr 1511 schloss sich in Biberwier zur Förderung der Erzvorkommen am Schachtkopf eine bergmännische Gewerkschaft zusammen, welche über dreieinhalb Jahrhunderte lang in privater Hand geführt, das Bergbaugebiet
Silberleithe, oder auch Silberleithen, bald zum größten und bedeutendsten Grubengebiet des Gerichtes Ehrenberg erstarken ließ.
Der Tiroler Landesfürst Ludwig der Brandenburger verleiht am 16. Oktober 1352 in München an Jacob Freymann und Grimoald dem Drechsel, sowie einem gewissen Friz (Fritz) das Recht, im Gericht Landeck, aber auch zu Musau, Pinswang und am Plansee nach Eisen zu schürfen.
nach oben
Abbauarten mit regionaler Besonderheit
Eisenerz
Bei der Gewinnung von Eisenerz beschränkt sich die Abbauart zumeist auf das "Sammeln" von an der Oberfläche aufgefundenen vererzten Gesteinen. Nur eher selten wurden Stollen oder Gänge für den Eisenerzabbau angelegt, da die Einschlüsse meist ganz vereinzelt auftraten und so gut wie nie eine zusammenhängende Erzader ausbildeten. Beim Schürfen nach Eisen waren mit großer Wahrscheinlichkeit auch keine ausgebildeten Bergleute beschäftigt. Viel eher kann angenommen werden, dass diese Arbeiten von Waldarbeitern und Bauern im Nebenerwerb getätigt wurden.
Silber, Blei und Zink
Die Förderung von Silber, Blei und Zink wurde zu Beginn des 16. Jahrhunderts speziell im Bereich der Silberleithe bei Biberwier zumeist mittels in den Berg gehauenen Stollen und Schächten im Untertagebau bewerkstelligt. Mit Schlägel und Eisen trieb man diese in den kompakten Fels um an die Erzadern zu gelangen. Das erzhaltige Gestein wurde im Anschluss zunächst nahe der Stollen in kleinen Rennöfen ausgeschmolzen. Der zunehmende Bedarf an Feuerholz machte es um die Mitte des 17. Jahrhunderts aber notwendig, eine Schmelzhütte im talnahen Bereich zu errichten.
Dabei nutzten die Bergmänner Karren und spezielle Tragkraxen im Sommer oder Schleifen, Häute (Sackzug) und Schlitten im Winter, um das Erz zu der Sammelstelle oder der Hütte zu transportieren. Gerade die beim Sackzug entstandenen Hohlwege sind heute teilweise noch gut in der Landschaft erkennbar.
Verhüttung der Erze
Noch heute finden sich Flurnamen wie Schmölz oder Schmelz in den einstigen Bergbauarealen. Dort befanden sich die Öfen um das Erz zu rösten und in Schachtöfen das Metall auszuschmelzen. Zu den ältesten Örtlichkeiten der Verhüttung zählen Roßhaupten, Osterreinen (am Forggensee) und das Umfeld des Frauensees, welche mindestens seit dem Frühmittelalter (etwa 650 bis 700 n. Chr.) in Betrieb standen. Eine keltische Eisenverarbeitung ist im Grunde nach derzeitigem Wissensstand auszuschließen, da die in ganz Mitteleuropa aufgefundenen Schlackengruben jener Zeit - die sogenannten
"Ofensäue" - nirgends im Einflussgebiet entdeckt wurden.
Die Schmelzplätze legte man offenbar nur selten in der Nähe der Erzvorkommen selbst an, sondern zum größten Teil im Alpenvorland. Dort waren mutmaßlich die Holzreserven und Holzrechte bzw. die Lage der Köhlereien für die Wahl eines Verhüttungsstandorts ausschlaggebend.
nach oben
Abbaugebiete
Allgäuer Alpen
- Altstädten (Sonthofner Hörnle) - Sonthofen (Eisenerz)
- Bärgündelealpe / Bärgündeletal - Hinterstein
- Breitenberg / Elpenalpe - Hinterstein
- Burgschrofen - Bad Hindelang
- Entschenalpe / Hinteres Retterschwanger Tal - Bad Hindelang
- Erzeck / In der Schiene - Hinterstein
- Fischersäge - Nesselwang (Kohle)
- Fuchslöcher - Staig bei Sonthofen
- Gaisalpe - Reichenbach bei Oberstdorf
- Grünten - Burgberg, Wagneritz, Starzlach Quellgebiet (Verhüttung: Ofenwald, Sonthofen [möglicherweise seit römischer oder gar vorrömischer Zeit])
- Gunzesrieder Tal
- Hintere Seealpe / Hüttenkopf - Oberstdorf
- Hirschberg - Bad Hindelang
- Hornbachklamm - Bruck bei Bad Hindelang
- Hüttenberg - westlich von Sonthofen
- Kaisergrube - Bad Hindelang
- Krebenloch / Schönhaldenkopf (Langenwang bei Oberstdorf)
- Löwenbachtobel - Imberg (Kohle)
- Oberstaufen (Kohle)
- Ochsenalpe / Bärgündeletal - Hinterstein
- Retterschwangalpe - Bad Hindelang
- Ritterstollen / Vordere Seealpe - Oberstdorf
- Roßkopf / Sattelhütte - Hinterstein (Eisenerz)
- Schnippe / Retterschwanger Tal - Bad Hindelang
- Schochenalpe? - Holzgau
- Schöllangerhof am Sonnenkopf - Schöllang
- Tiefenbacher Eck - Tiefenbach bei Sonthofen
- Unterried / Walten - Sonthofen
Ammergauer Alpen
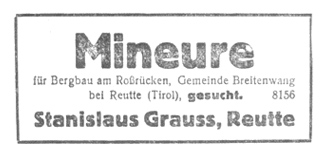
Bergbau am Roßrücken nahe Breitenwang, 1919
- Älpeleskopf - Schwangau
- Altenbergalpe - Schwangau
- Ammersattel - Ammerwald
- Erzgruben - Unterpinswang
- Galmeikopf - Unterpinswang
- Grüble / Branderschrofen - Schwangau
- Halblech / Pfefferbichl (Braunkohle; späte 1940er Jahre)
- Eschenberg bei Halblech - Verhüttungsplatz, Schmieden?
Auszug aus Ortsgeschichte von Trauchgau bei Füssen, von Urban Schaidhauf (1892):
...St. Magnus zeigte den Bekehrten auch die Auffindung von Eisenerz und sollen auf dem Eschenberge ein paar Schmieden gestanden sein, was durch die mannigfachen Eisenschlacken, welche in den dortigen Feldern gefunden wurden, bestätigt wird...
- Hennenkopf / Erzgraben - Linderhof
- Hirschwanghütte? / östlicher Sattel
- Hochplatte - Beinlandl bzw. Wilder Freithof
- Klemmtal / Säuling - Pflach
- Kühbachtal? - nördl. Plansee (Kohle)
- Niederstraußbergsattel / Erzgrube - Schwangau
- Pflacher Messinghüttenwerk am Steineberg
- Pilgerschrofen - Pflach
- Roßrücken - Breitenwang
- Sägertal - Linderhof
- Schlagstein - Schwangau
- Tortal? - nördl. Plansee (Kohle, Ölschiefer)
- Weitalpspitze
- Zunterkopf - Schwangau
Lechtaler Alpen
Tannheimer Berge
- Daurachalpe / Sebenspitze - Vils
- Erzstollen - Weißenbach
- Frauensee / Erzberg - Lechaschau
- Greng - Musau
- Gelber Gang (Hochwald am Gachtberg) - Weißenbach
- Hahlealpe / Hahlekopf - Musau
- Hahlekopf / Frauenwald (Steinkohle)
Tschirgant
- mehrere Grubenbaue an der Tschirgant-Westflanke - Imst
- Silbertal - Roppen
Wetterstein und Mieminger Berge
- Arzberg - Telfs
- Bärlesgrube? - Ehrwald
- Drachensee - Ehrwald (Blei; vor 1500)
- Emat - Telfs
- Feigenstein / Knappenwald - Nassereith (Blei, Galmei)
- Frohnhausen / nördl. - Barwies
- Geierkopf - Nassereith (Blei, Silber, Galmei)
- Grünstein / Arzbödele und Gamswannele - Biberwier
- Handschuhspitze - Nassereith (Blei)
- Haverstock - Nassereith (Blei, Galmei, Zink)
- Hochwart - Nassereith (Blei, Galmei)
- Igelskopf / östl. im Kar - Ehrwald (Galmei, Blei)
- Kotbachgraben / Tillfussalm / Gaistal - Leutasch
- Marienbergjoch - Biberwier (Blei, Galmei, Silber)
- Muthenaualm / Nassereither Alm - Nassereith (Mangan, Eisenerz)
- Nassereith / Sigmund- u. Matthias-Grube (Blei, Galmei, Zink)
- Roßbach - Nassereith (Schmelzhütte)
- Schachtkopf / Silberleithe - Biberwier (Blei, Silber, Zink)
- Schnahnggekopf / südl. - Nassereith
- Seebensee - Ehrwald (Galmei; 1735 eingestellt)
- Wampeter Schrofen - Biberwier
- Wannig - Biberwier (Kohle, Mangan, Ichthyol)
Ostrachtal
Eine erste urkundliche Erwähnung für den Bergbau im Ostrachtal ist für 1471 überliefert, als Kaiser Friedrich III. dem Grafen Haug von Montfort-Rothenfels das
Bergwerksregal innerhalb seiner Allgäuer Besitzungen verleiht. Bereits 1489 wird von zahlreichen bergbaulichen Gewerken berichtet, wie etwa in Oberdorf bei Hindelang eine Schmelze und ein Hammerwerk, welche von 15 Gruben im Tal beschickt werden. Als vorrangigen Verwendungszweck der Erze bildet sich schon bald die Herstellung von Waffen heraus, so ist 1520 von Immenstadt als Ort für die Waffenproduktion die Rede.
Mitte des 16. Jahrhunderts haben alle Schmelzhütten im Ostrachtal und dem Illertal um Sonthofen mit dem Nachschub an Holz und Kohle zu kämpfen. Sämtliche Waldflächen im Tal sind großteils abgeholzt und die Kohlemeiler bleiben oftmals kalt. 1552 wird daraufhin eine Holzordnung erlassen, welche die Nutzung der Wälder fortan regelt. So darf für die Holzkohle nur noch das Holz "unfruchtbarer Tannen-, Birken- und anderem Holz gewonnen werden, das zur Herstellung von Schindeln, zum Schneiden und Zimmern nichts taugt". Trotzdem wurden die Wälder weiterhin regelrecht geplündert, sodass 1573 lediglich noch 3 unversehrte Wälder im Tal existieren. Letztlich führt dieser Holzmangel zur Schließung der Hindelanger Hütte (1578) und auch des Blaichacher Hüttenwerks (1591).
In den Jahrzehnten danach werden noch Erzabbaue für Galmei (Roßkopf) und später die Untersuchung der Fließgewässer nach Gold erwähnt, welche auch gleich die Glücksritter auf den Plan rufen, die die Gewässer nach dem begehrten Edelmetall absuchen. Offenbar handelte es sich dabei vorwiegend um italienische Goldsucher, denn diese sollen aufgegriffen und "sogleich verhaftet und verhört werden". Auch auf der Alpe Entsche soll es Golderze gegeben haben, die aber nach Aussage der Akten wohl "von den Welschen weggetragen wurden".
In Oberdorf bei Hindelang werden im Jahr 1830 folgende Gewerke aufgezählt: 28 Nagelschmieden, 1 Hammerschmiede und 12 Waffenschmieden. Durch die zunehmende Industrialisierung und das in seiner Qualität lediglich mittelmäßige Metall der Region werden die Hütten und Bergwerke im Ostrachtal und bei Sonthofen zunehmend unrentabel. Das staatliche Hüttenwerk Sonthofen etwa fährt herbe Verluste ein. 1859 wird der Bergbau endgültig eingestellt und nach und nach werden sämtliche Werke geschlossen.
"...Eisenwerke waren in Blaichach und Hindelang, beide im 16. Jahrhundert von Ulmer Kaufleuten betrieben. Das erstere bezog sein Eisen seit 1566 vom Grünten, gieng aber, als die Rettenberger Beamten ihm kein Grünteneisen mehr zugehen ließen, nach einem Bestande von 29 Jahren für immer ein. Auch das Werk in Hindelang hatte geringen Ertrag. Die bischöfliche Regierung wollte es darum schon 1574 einstellen ; aber die Ulmer, die es betrieben, waren dagegen, weil sie zu viel Geld in dasselbe gesteckt hatten.
So fristete es, wie der 1607 in Sonthofen angelegte Schmelzofen, das Dasein fort, zum großen Ärger der Rettenberger Gemeinden, welche diese Werke immer wieder der Holzverwüstung anklagten.
Ein drittes Eisenwerk, das aber ebenfalls keiner besonderen Blüthe sich erfreute, legte Österreich zu Anfang des 18. Jahrhunderts im Schüttentobel unter Hohenegg an...
...unbedeutend war der Bergbau im Allgäu während der neueren Zeit. Die Eisenbergwerke im Hindelanger Thale giengen im 17. Jahrhundert wegen zu geringen Ertrages ein; ein Versuch des Ferdinand Aniser, sie 1794 wieder zu beleben, blieb erfolglos. Von den Erzgruben zu Tiefenbach, Imberg und Reichenbach aber hören wir schon im 16. Jahrhundert nichts mehr; auch das Eisenerz in Hüttenberg bei Sigishofen, das im 16. Jahrhundert gewonnen wurde, lohnte schon 1598 das Sammeln nicht mehr. Dagegen lieferte der Grünten bis 1802 viel Eisenerz. Ohne Erfolg blieben die Versuche, im Menelzhofer Berg bei Jsny um 1600 und wieder 1787 Braunkohlen und Agtstein zu gewinnen; nicht glücklicher war im 18. Jahrhundert das Stift Kempten mit einem zweimaligen Schürfen nach Steinkohlen. Ebenso war die Anlage von Marmorbrüchen bei Oberstdorf im 18. Jahrhundert nicht lohnend, man gab sie deßhalb bald wieder auf... [...] ...Bedeutend blieb bis in den Schwedenkrieg herein zu Wangen die Sensen- und Waffenschmiederei. Spieße verfertigte man im 16. Jahrhundert besonders in Jmmenstadt und Hindelang; so bezog König Ferdinand 1538 Tausende von Spießen von Konrad Prell zu Jmmenstadt und 1552 von Hans Hohenegg zu Hindelang..." Die Geschichte des Allgäus, Ludwig Baumann (1883)
Bergbau am Älpeleskopf bei Schwangau
Im Bereich Schwangau, Füssen, Pinswang und Pflach finden sich zahlreiche Abbaugebiete und Stollen an den Flanken des Säulings. In einer Schenkungsurkunde von 1095 überlässt Herzog Welf V. den Klöstern Rottenbuch, Sankt Mang in Füssen und jenem zu Steingaden mehrere Gewerke.
Bergbau bei Pinswang


Daurachalpe bei Vils
Von den Erztransporten von der Daurachalpe ist überliefert, dass das Erz mit Eseln zur Schmelze transportiert wurde.
Almajur
In einer Urkunde des
Erzherzogs Sigmund vom 16. März 1472 wird von einem Eisenbergwerk im Almajurtal berichtet, welches der Pfleger zu
Kronburg, Hans Klammer, sowie die erzherzoglichen Dienstleute Valentin von Pudnau und Hans Sprenger gemeinsam betreiben. Diesen wird zudem zum Betrieb des Bergwerks das Holzrecht im Rotlech- und dem Krabachtal verliehen.
Ein Auszug aus einer Zeitung von 1867 berichtet folgendes:
"Zwischen der Alpe Boden und Erl im Thale Almajur steht eine gezimmerte Hütte [...] ober dem Eingange steht mit großen Buchstaben der bergmännische Spruch: 'Glück auf!'
Der von dem baierischen Grafen Türkheim hier begonnene Bau auf Eisenerz hat sich trotz des ergiebigen Vorkommens dieses Gesteins nicht rentirt. Der unternehmende Graf soll durch seine vielen, auf Bergwesen gerichteten Spekulationen um all sein Vermögen gekommen sein. Die bergmännischen Werkzeuge, welche pfandweise bei der hiesigen Gemeinde [Kaisers] liegen, wurden nicht mehr abgelöst. Der Bergbau im genannten Thale ist übrigens nicht neu, mehrere noch offene Gruben, zum Theil in Felsen getrieben, stammen aus älterer Zeit, wahrscheinlich aus dem 16. Jahrhundert, wo in Tirol die Sucht nach Erzen wie eine Krankheit grassirt zu haben scheint. Die meisten, auf den höchsten Bergen und in den tiefsten Thälern noch gegenwärtig bemerkbaren Gruben und Halden stammen, wie sich urkundlich leicht nachweisen ließe, aus jener Zeit. Aber der Ruf 'Glück auf' verhallte..."
Alperschon / Knappenböden
1472 betreibt eine Gewerkschaft im Alperschon zu Feustarb ein Eisenbergwerk, wobei auf der Knappenbodenalpe mehrere Schmelzhütten und Häuser gestanden haben sollen.
Roßhaupten
Schlackefunde im Dorfzentrum von Roßhaupten lieferten den Beweis, dass bereits seit dem frühen 7. Jahrhundert Eisen an dieser Stelle verhüttet wurde. Das Erz stammte vorwiegend aus dem Wettersteinkalk des Raumes Reutte und Umgebung (Säuling, Frauensee, usw.), wurde zu Beginn aber nicht mittels Stollenbau sondern mehrheitlich durch Aufsammeln an der Oberfläche gewonnen. Zum Einsatz kamen im Bereich Roßhaupten die sogenannten Rennöfen, einer alten aber bald schon überholten Art zur Gewinnung der Erze.
Grünten - Sonthofen
In einer Sarkophaginschrift Ende des 2. Jahrhunderts aus Augsburg wird ein gewisser Publius Frontinius Decoratus als Großpächter von Eisenerzbergwerken in Rätien genannt. Mit einiger Wahrscheinlichkeit handelt es sich bei einem dieser Eisenerzbergwerke um jenes am Grünten, welche oolithische Brauneisenerze des Eozäns preisgaben.
Auszug aus dem Buch 'Die Algäuer Alpen bei Oberstdorf und Sonthofen - ein Führer für Fremde' (S.175, 1856)
"...nach [...] dem Dorfe Burgberg liegt halb Wegs das königl. Hüttenwerk Sonthofen, welches die am Grünten brechenden Toneisensteine, so wie Bohnerz aus dem schwäbischen Jura verarbeitet. Die ausgedehnten, durch gegenwärtige zeitgemäße, vortreffliche Leitung rasch aufblühenden Werke verdienen in hohem Grade unsere Aufmerksamkeit. Die Betriebs-Einrichtungen umfassen einen Holzkohlen-Ofen, zwei Cupol-Öfen, zwei Puddling-Öfen, mehrere Schweiß-Streckfeuer, ein Kleineisen-Walzwerk und eine vollständige mechanische Werkstätte mit den dazu gehörigen Zeugschmieden. Im Baue begriffen und teilweise der Vollendung nahe sind ein Grobeisen-Walzwerk mit einer Dampfmaschine von 50 Pferdekräften, mehrere Schweißöfen, durch deren Abhitze die Dampfmaschine geheizt wird, und hiezu ein 90' hoher Dampfkamin. Als Brennmaterial dient Holzkohle aus den Waldungen der umliegenden Gebirge gewonnen, bei den Puddling- und Schweiß-Öfen Torf, der in der Umgebung in großen Quantitäten vorhanden ist. Die jährliche Produktion beträgt zur Zeit beläufig 9000 Zentner Gußwaren und etwa 15000 Zentner Schmiedeisen. In dem Werk selbst finden 250 Arbeiter verdienst, und außerdem fließen den Bewohnern des Iller- und Ostrachtales durch Torfstechen, Holzfällen, Kohlenbrennen und Werkfuhren bedeutende Summen zu..."
Tarrenton und Schmelzhütte Imst
1460 vergibt
Erzherzog Sigmund an mehrere Gewerke die Schürfrechte im Tarrenton. 1471 laufen die Verträge aus und Sigmund setzt Stephan Yserecker und dessen Gemahlin Agnes als neue Betreiber ein. Auch sie bauen Galmei ab, verarbeiten es jedoch in der Nähe zu Messing. 1472 bestätigt der Erzherzog den Ysereckern die Vertragsverlängerung bis 1474.
Der Sage nach geht der erste Bergbau am Dirstentritt auf den aus dem Karwendel stammenden Riesen Thyrsus zurück, welcher während der Bärenjagd mit einem Fußtritt die Erzader an der Ostflanke des Alpleskopfs freilegte. Eine erste urkundliche Erwähnung für Dirstentritt findet sich für das Jahr 1565.
Votivtafel in der Kapelle bei Sinnesbrunn "...das Gnadenbild Maria ist vor alten Zeiten in diesem Wald auf einem Baum gestanden. Die Bergknappen sind schon dort die ersten und besten Verehrer gewesen und haben öfters an selbem Baum ein Lichtlein angezündet..."
Noch heute ist die Hochfläche unterhalb des Sinnesegg und die Abhänge gegen Südwesten von Hohlwegen zerfurcht. Vermutlich wurden auf ihnen die Erze aus dem Gebiet Tarrenton, Dirstentritt, Reissenschuhtal und Gaflein über das Sinnesgatter und vorüber an Sinnesbrunn hinab zu der Schmelzhütte bei Imst transportiert.



Erzstollen bei Weißenbach
Abschrift der Infotafel bei den Erzstollen
Eisenerzabbau in Weißenbach
Zur Zeit der Salztransporte von Hall über den Fernpass nach Reutte und durch das Tannheimer Tal nach Lindau wurden die Pferdefuhrwerke bei Ehenbichl per Floß auf die gegenüberliegende Seite nach Höfen übergeführt. Am Ortseingang von Weißenbach betrieb der alteingesessene Huf- und Nagelschmied Zitt eine Schmiede, wo die Pferde beschlagen werden konnten.
Das Rohmaterial dafür wurde aus diesem Stollen und unterhalb sogar frei abgebaut und an Ort und Stelle verarbeitet.
Zu dieser Zeit sollen sich rund 50 Gewerbebetriebe in Weißenbach angesiedelt haben.

Frauensee / Erzberg
Geschichte des Allgäus - Baumann (1883)
"…bereits in sehr früher Zeit betrieb das Kloster Füßen Bergbau, freilich nicht im Allgäu, sondern bei Aschau im Lechthal; das von ihm hier gewonnene Erz und der aus demselben erzeugte 'Ekol' (d.i. Stahl) durfte im 14. Jahrhundert nur auf dem Markte zu Füßen verkauft werden…"


 aus: Tiroler Volksbote vom 18. Nov. 1920
"...im sogenannten Sulztal hat ein Münchner Herr namens Josef Burger das Schurfrecht erworben. Derselbe läßt nach Steinkohlen graben und es kamen in der Tat welche zum Vorschein. Man findet auch alte Stollen, weil ungefähr vor 50 Jahren ebenfalls nach Steinkohlen gegraben wurde. Wie weit die Ergiebigkeit reicht, ist allerdings eine Frage. Jedoch ist die Annahme berechtigt, daß Steinkohlen wohl auch in der Tiefe sich befinden werden..."
aus: Tiroler Volksbote vom 18. Nov. 1920
"...im sogenannten Sulztal hat ein Münchner Herr namens Josef Burger das Schurfrecht erworben. Derselbe läßt nach Steinkohlen graben und es kamen in der Tat welche zum Vorschein. Man findet auch alte Stollen, weil ungefähr vor 50 Jahren ebenfalls nach Steinkohlen gegraben wurde. Wie weit die Ergiebigkeit reicht, ist allerdings eine Frage. Jedoch ist die Annahme berechtigt, daß Steinkohlen wohl auch in der Tiefe sich befinden werden..."
Mit dem Erzabbau am Erzberg über dem Frauensee und am Frauensee selbst scheint auch eine größere Schlackeansammlung des Verhüttungsprozesses am sogenannten Schwemmberg bei Pflach (Unterletzen) und einem kleineren bei Lechaschau im Unterdorf in Zusammenhang zu stehen. Auffällig sind hier die Flurnamen Rotries und Ladstatt im unmittelbaren Umfeld des Frauensees.
Flurbezeichnungen welche einen Hinweis auf ehemalige bergbauliche Aktivitäten geben können:
- Arz... (Erz)
- Eisen...
- Erz...
- ...grube
- Grubig(...)
- Knappen...
- ...loch
- Putzen...
- Rot...
- Schacht...
- Schmelz oder auch Schmölz
- Silber...